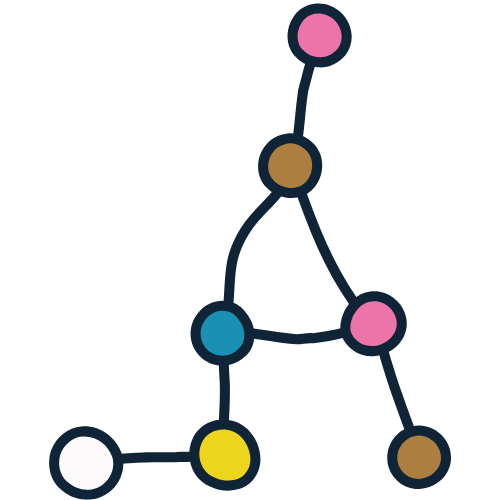Ein Erfahrungsbericht aus dem fachfremden Unterricht in Darstellendem Spiel
Im letzten Schulhalbjahr durfte – und musste – ich zum ersten Mal das Fach Darstellendes Spiel im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts der Jahrgangsstufe 10 unterrichten. Ein Kollege hatte seinen Auslandsschuldienst angetreten, und so wurde ich gefragt, ob ich übernehmen könne. Ich denke, dass die Wahl auf mich fiel, weil ich durchaus ein grundsätzliches Interesse an diesem Fach habe. Doch eine Fort- oder Weiterbildung in diesem Bereich habe ich bislang nicht gemacht. Ich habe es also ein halbes Jahr lang fachfremd unterrichtet – mit allem, was dazu gehört.
Fremdheit zwischen Improvisation und Irritation
Ich startete mit einem klassischen Einstieg: Übungen zu Improvisation, Bühnenpräsenz, neutralem Gang, Sprache, Raumwahrnehmung und peripherem Blick. Ich hatte mir einen Plan zurechtgelegt, der auf theaterpädagogischen Grundlagen beruhte – und doch merkte ich schnell: Etwas passte nicht. Die Motivation der Schüler:innen sank von Woche zu Woche. Ich spürte eine wachsende Irritation – bei ihnen und bei mir.
Im Gespräch mit der Gruppe wurde deutlich: Für etwa die Hälfte war Darstellendes Spiel nur die Ersatzwahl. Sie hatten sich ursprünglich für andere Kurse entschieden, wurden aber aufgrund zu hoher Anmeldezahlen nicht aufgenommen – und so sind sie in DS „gestrandet“.
Für die Schüler:innen war die Gesamtsituation eine Fremdheitserfahrung, der sie sich nicht öffnen konnten. Vielleicht auch, weil sie sich schämten? Ich entschied mich also, meine Pläne über Bord zu werfen.
Fremdheitserfahrungen bezeichnen in der Kulturellen Bildung Momente, in denen Menschen mit etwas konfrontiert werden, das ihnen zunächst ungewohnt, irritierend oder widersprüchlich erscheint – sei es ein ästhetisches Ausdrucksmittel, eine neue Perspektive, eine ungewohnte Rolle oder ein kultureller Kontext. Diese Erfahrungen lösen oft Unsicherheit oder Irritation aus, können aber zugleich produktive Lernprozesse anstoßen.
In der Auseinandersetzung mit dem „Fremden“ – im Sinne des Nicht-Vertrauten – entsteht ein Raum, in dem gewohnte Denk- und Handlungsmuster hinterfragt und neue Sichtweisen entwickelt werden können. Fremdheitserfahrungen sind damit Schlüsselprozesse ästhetischer Bildung: Sie fordern heraus, regen zur Reflexion an und eröffnen Möglichkeiten zur Selbstveränderung.
In pädagogischen Kontexten bedeutet das: Lehrende müssen nicht alle Unsicherheiten auflösen, sondern können gezielt Räume schaffen, in denen Schüler:innen sich mit dem Unvertrauten auseinandersetzen – sei es in einem Theaterprojekt, beim Perspektivwechsel in einer Performance oder im Umgang mit neuen Medienformen. Entscheidend ist, dass diese Erfahrungen begleitet, reflektiert und ernst genommen werden.
Dank meines Studiums der „Kulturellen Bildung an Schulen“ an der Philipps-Universität Marburg war ich auf eine solche Fremdheitserfahrung eingestellt, hatte sie bereits kennengelernt – und mich selbst, wie ich in einer solchen Situation agiere. Ich hatte also glücklicherweise bereits gelernt, das Unbekannte freudig zu erwarten.
Alles auf Anfang – und dann: Kamera läuft!
Gemeinsam mit dem Kurs beschlossen wir, statt einer Bühnenaufführung einen Kurzfilm zu drehen – mit iPads, zum Thema Scripted Reality. Die Idee kam gut an – zumindest bei denen, die eher unfreiwillig im Kurs waren. Diejenigen, die gerne Theater spielen wollten, waren enttäuscht. Die Gruppe war wieder geteilt – nur diesmal andersherum.
Ich arbeitete einen klaren Fahrplan aus:
- 3 Doppelstunden zur Entwicklung der Figuren und der Handlung
- 2 Doppelstunden zum Schreiben der Dialoge
- 2 Doppelstunden zur Erstellung des Storyboards
- 3 Doppelstunden zum Drehen des Films
- 1 Doppelstunde zur Präsentation und Besprechung
Danach sollte alles „im Kasten“ sein. Die Schüler:innen bildeten Gruppen und legten los. Schnell zeigte sich: Manche Gruppen wollten den Plan nicht einhalten. Sie wollten sofort drehen, ohne Drehbuch, ohne Storyboard. Ich hatte Bedenken – aber ich ließ sie machen.
Und dann geschah etwas Unerwartetes: Die zuvor passiven Schüler:innen arbeiteten mit neuer Motivation. Sie trafen sich außerhalb des Unterrichts, schnitten Szenen, planten Requisiten, suchten Drehorte. Die Deadline war klar – das Schuljahresende ließ sich nicht verschieben. Und plötzlich war da Energie im Raum.
Sechs Filme – sechs Perspektiven auf das Großstadtleben
Am Ende entstanden sechs Kurzfilme – und alle Gruppen präsentierten wirklich tolle Ergebnisse: Von dem Tankstellenüberfall, über das Familiendrama mit Therapiesitzung bis hin zur actiongeladenen Verfolgungsjagd im Bahnhofsviertel war alles dabei. Szenen, die so oder so ähnlich in Frankfurt hätten stattfinden können – und vielleicht sogar stattgefunden haben. Die Filme waren nicht perfekt. Aber sie waren echt. Und sie waren das Ergebnis eines Prozesses, den die Schüler:innen selbst gestaltet hatten.
Was ich selbst gelernt habe
Ich habe gelernt, dass pädagogische Planung wichtig ist – aber nicht alles. Ich hatte keinen „Werkzeugkoffer“ für spontane Improvisation im DS-Unterricht. Und trotzdem habe ich mich darauf eingelassen, meine Pläne zu verwerfen und gemeinsam mit der Gruppe einen neuen Weg zu gehen. Aus der Fremdheitserfahrung einer kleinen Schüler:innengruppe ist eine Fremdheitserfahrung der Gesamtgruppe geworden – einschließlich mir als Lehrer. Und so konnten wir mit- und voneinander lernen.
Ich habe gelernt, dass Schüler:innen kreativ, engagiert und lernbereit sind – wenn sie das Gefühl haben, dass es um etwas geht, das mit ihnen zu tun hat.
Ich habe gelernt, dass ich nicht alles kontrollieren muss. Dass es okay ist, wenn ich nicht mehr der bin, der sagt, was zu tun ist – sondern der, der fragt, was er tun kann, um zu helfen.
Ich habe gelernt, dass ästhetisch-kreative Bildung Räume braucht: Räume, in denen junge Menschen sich ausprobieren dürfen. Räume, in denen Fehler erlaubt sind. Räume, in denen Lehrer:innen nicht alles wissen müssen – aber bereit sind, gemeinsam zu lernen.
Und ich habe gelernt, dass es manchmal reicht, den Rahmen zu gestalten – und dann loszulassen.
Ich wünsche mir, dass jede:r Kolleg:in mindestens einmal eine solche Erfahrung machen darf. Es verändert den Blick auf das eigene Tun immens.
In einer Welt, die sich zunehmend schneller dreht und wir weniger Zeit haben, uns und andere(s) kennenzulernen, muss schulische Bildung die Fremdheitserfahrung in den Fokus des Erlebens stellen, damit wir lernen, das Fremde zu gestalten.